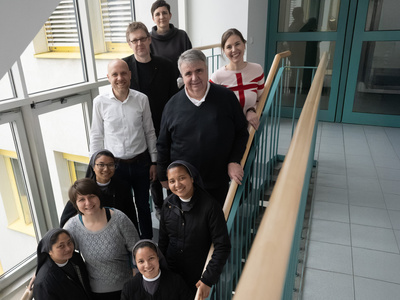Die Predigt im Wortlaut:
Lockdown – kurz vor Weihnachten: Die meisten Geschäfte müssen schließen, Kontakte werden reduziert, der Aufenthalt im öffentlichen Raum wird eingeschränkt, dazu ein Ausgehverbot ab 21 Uhr. „Das gilt auch für Weihnachten!“, verkündete der Ministerpräsident.
Sehr deutlich fiel mir die Auswirkung dieser Maßnahmen mitten in Würzburg auf dem Marktplatz auf. Die Verkaufsstände und Imbissbuden waren in kürzester Zeit abgebaut und verräumt. Aber nicht nur dies, auch die Krippe, die unter dem großen Christbaum stand, war weg. Dabei wäre gerade jetzt, wo aller Kommerz beiseite geräumt war, der Blick frei für die Krippe, die vorher zwischen den Marktständen kaum auffiel.
Wäre der Blick auf die Krippe, genauer gesagt auf den menschgewordenen Gott, nicht gerade jetzt wichtig? In der durch das Virus bedrohlichen Situation bräuchte es gestärkte Zuversicht, dass die Gefahr überwunden wird, dass wir einander schützen und das Problem nicht durch Leichtsinn weiterverbreiten.
Doch die unterschiedlichen Reaktionen machen mir Sorge: Die einen kapseln sich ab, meiden soziale Kontakte, die anderen demonstrieren Stärke, sind zu keiner Einschränkung bereit und versuchen zu provozieren. Als schlimm erachte ich in diesem Zusammenhang das Denunziantentum, das auflebt. Auch das um sich greifende Misstrauen macht mir Sorgen, hinter allem ist Verschwörung, Absicht und böser Wille zu sehen, und zugleich werden Menschen, die eine andere Meinung haben, mit Spott und Hass überzogen. Ob ein Querdenker, der seine individuelle Freiheit einfordert, bei den Demos an die Menschen denkt, deren wirtschaftliche Existenz bedroht ist, oder an die, die auf einer Intensivstation liegen und beatmet werden? Aber auch das Agieren der Politik ist für mich fragwürdig. Offenbar wird den Menschen kein Verantwortungsbewusstsein mehr zugetraut. Alles wird vorgeschrieben und reglementiert.
Gerade deshalb ist die Botschaft dieser Nacht so lebenswichtig: „Fürchtet euch nicht!“ Das war die Botschaft des Engels an die Hirten, die alles, was sich da ereignete, nicht verstehen konnten. „Euch ist heute … der Retter geboren; er ist der Messias, der Herr.“ Genau darum geht es an Weihnachten. Wir werden daran erinnert und feiern, dass wir in allem Dunkel der Welt und unseres Lebens, in allen Unsicherheiten, Sorgen und Ängsten vertrauen dürfen: ER kommt uns entgegen. ER geht mit uns auf allen Wegen. ER leitet uns an bei unserem Tun.
Deshalb erachte ich den Vorgang, den ich auf dem Marktplatz in Würzburg beobachtet habe, als symptomatisch. Es wird kein Handel mehr betrieben, nichts mehr umgesetzt, also ist Weihnachten beendet. Die Krippe war halt nur ausschmückendes, sentimentales Beiwerk, ohne Bedeutung. Genau deshalb sind wir eigentlich arm dran. Denn alle Hoffnung wird auf den Impfstoff gesetzt, um schnell wieder in bisheriger Weise zu leben. Doch wenn diese Pandemie EINEN Sinn gehabt haben soll, dann allenfalls den, dass wir nachdenklich werden und uns fragen, was Leben ist und was das Leben ausmacht. Dazu gehören unsere Begrenztheit wie auch das Miteinander und die Solidarität, sowie unerschütterliche Hoffnung und Gottvertrauen.
Doch trotz aller ausgefeilten Abstands- und Hygienekonzepte, trotz des in den vergangenen Monaten bewiesenen verantwortungsbewussten Umgangs damit, werden die Gottesdienste, in denen die rettende Botschaft verkündet und gefeiert werden soll, zeitlich eingeschränkt. Die entfachte Diskussion brachte sogar die Erkenntnis, dass die Mehrheit der Bevölkerung den Politikern recht gibt, die Gottesdienste an Weihnachten ganz verbieten wollten.
Es erfüllt mich mit Sorge, dass eine Politik salonfähig wird, in der „Vater Staat“ mehr und mehr in das Privatleben der Menschen eingreift und alles reglementiert – angefangen von der Erziehung und Betreuung der Kinder über viele Dinge des täglichen Lebens bis hin zum selbstbestimmten Sterben, aber auch zur Praxis und der Feier des Glaubens. Dahinter nehme ich den Verlust an Gottvertrauen sowie das Bewusstsein wahr, selbst alles nach eigenen Vorstellungen zu regeln.
In einem Brief schrieb mir ein Chefarzt, mit dem ich immer wieder in Kontakt bin, jetzt zu Weihnachten: „Wir erleben eine ungeheure Ambivalenz: Auf der einen Seite Angst und Misstrauen, auf der anderen Seite die Herausforderung mit dem Unausweichlichen ‚irgendwie‘ fertig zu werden und sich dem Unbekannten zu stellen. Vielleicht führt es immerhin zu mehr Demut in allen Bereichen unseres Lebens – das ist ein dringender Wunsch von mir für die Zukunft … möge uns Gott im nächsten Jahr weiter begleiten.“
Diese Haltung zeugt von Größe: Über alles eigene Bemühen hinaus auf Gott zu vertrauen. Aus dieser inneren Haltung entstand auch das Lied „Stille Nacht! Heilige Nacht!“ Aus der Not geboren erklang es 1818 zum ersten Mal und ging in kürzester Zeit um die ganze Welt. Berührend und wertvoll ist nicht nur die zu Herzen gehende Melodie, vielmehr der Anlass für den Text des Gedichtes.
„Aus der Not geboren“, nicht nur weil die Orgel nicht funktionierte; „aus der Not geboren“ vielmehr, weil die Not der Menschen infolge der napoleonischen Kriege durch die Ereignisse im Jahr 1816 gesteigert wurde. Jenes Jahr ging in die Geschichte ein als „das Jahr ohne Sommer“. Es war ein ungewöhnlich kaltes Jahr mit Frost, Schnee und Eisstürmen von April bis September und mit unvorstellbaren Überschwemmungen. In Deutschland z.B. ging im Blick auf das Elendsjahr der Ausdruck „Achtzehnhundertunderfroren“ um. Missernten führten zu massiv gestiegenen Getreidepreisen und schließlich zu Hungersnöten in weiten Landstrichen. In Bayern trug die Krise zur Ablösung des Ministers und Staatsreformers Maximilian von Montgelas im Jahr 1817 bei.
In dieser Zeit richteten mehr und mehr Menschen ihren Blick auf Gott. In Scharen pilgerten sie z.B. nach Altötting. Bittgottesdienste für eine gute Ernte wurden sogar von der Obrigkeit angeordnet, ebenso die Abgabe von vergünstigtem Brot. Der geschichtliche Hintergrund ist wichtig, um die Botschaft des zu Herzen gehenden Liedes zu verstehen, denn es ging dabei um das Leben mit all seinen harten Seiten. Beide Schöpfer des Liedes, der Hilfspfarrer Joseph Mohr sowie der Lehrer Franz Xaver Gruber, kannten Armut und Not aus eigenem Erleben.
Die Ereignisse unserer Zeit sind bedenklich: Wir kämpfen mit einem Virus, das nicht nur das Leben des Einzelnen bedroht, sondern auch unser Miteinander nachhaltig beeinträchtigt. Wir halten Abstand, Distanz. Die anfänglich erhoffte Solidarität hat sich schnell auf einen Kreis von unermüdlich Engagierten reduziert. Mehr und mehr Ungeduld macht sich breit mit Vorwürfen in alle Richtungen. Reisebeschränkungen, um Urlaub machen zu können, werden als unerträgliche Zumutung empfunden.
Durch die täglichen Corona-Meldungen geraten die anderen bedenklichen Entwicklungen unserer Tage in den Hintergrund z.B. die sozialen Spannungen etwa in Frankreich, die zunehmend nationalen Bestrebungen wie u.a. in Ungarn, Polen, aber auch in England, die Uneinigkeit in der Europäischen Union, die Spannungen zwischen USA, Russland, China. Dazu kommen die vielen Auseinandersetzungen und terroristischen Bedrohungen im Nahen und Mittleren Osten, in Ländern Lateinamerikas, Afrikas und Asiens mit mehr als 70 Millionen Menschen auf der Flucht, dazu die sich anbahnenden besorgniserregenden ökonomischen und insbesondere ökologischen Entwicklungen rings um die Welt.
Wer macht sich Gedanken um die Bewertung ungeborenen wie auch geborenen, gebrechlichen, behinderten, hilfsbedürftigen Lebens? Die mangelnde Bereitschaft zu Solidarität und sozialem Engagement ist gefährlich, ebenso die zunehmende Aggressivität und Gewaltbereitschaft im zwischenmenschlichen Bereich bis hinein in manchen Familien.
Wenn uns all das bewusst ist, drängt sich die Frage auf, was es bedeutet, wenn wir singen: „Gottes Sohn! O! wie lacht / Lieb’ aus Deinem göttlichen Mund, / da uns schlägt die rettende Stund …“
Der menschgewordene Gott war von Anfang an bei den Ausgegrenzten, den Armen, wendete sich den Ohnmächtigen zu, versuchte allen einen guten Weg für ihr Leben und Handeln zu zeigen und schenkte die Verheißung vom Leben in Fülle bei Gott.
All das sollte den Menschen gerade jetzt bewusst werden. Anstatt über Einschränkungen wegen der Pandemie zu jammern, sollen Menschen lieber etwas für jene tun, die weniger haben, mahnte Papst Franziskus am vierten Advent. Dabei kritisierte er vor allem die am Konsum ausgerichteten Festvorbereitungen. „Der Konsumismus hat uns Weihnachten geraubt“, sagte er. An der Krippe von Bethlehem habe es keinen Konsum gegeben, sondern die Realität des Lebens, die „Wirklichkeit von Armut und Liebe“.
Wie den Menschen vor zweihundert Jahren in der Zeit der Entstehung des „Stille Nacht“ so ist es auch heute wichtig, die Botschaft des menschengewordenen Gottes, der keine Distanz zu den Menschen hält, der auf sie zugeht, bei ihnen sein will vom Stall in Betlehem bis zum Kreuz, zu bezeugen durch unsere Gottesdienste und von da aus durch unseren Umgang miteinander und unseren Einsatz für die Welt.
Der Lockdown kann eine augenblicklich erforderliche Maßnahme sein. Das darf uns aber nicht davon abhalten, in den Menschen das Vertrauen zu bestärken, dass Gott bei uns ist, und dass es eigentlich keinen Lockdown bräuchte, wenn Menschen in SEINEM Geist miteinander umgingen und füreinander sorgten.
Schade, dass die Krippe vom Marktplatz entfernt wurde. Sie wäre gerade jetzt ein wichtiger Hinweis, dass Gott unsere Not sieht, bei uns sein will und durch seine Engel verkündet: „Fürchtet euch nicht! Euch ist der Retter geboren!“ Weil diese Hinweise heute fehlen, sollten wir Christen uns nicht scheuen, mit innerster Überzeugung zu bekennen: „Lobt Gott, ihr Christen alle gleich, in seinem höchsten Thron, der heut schließt auf sein Himmelreich und schenkt uns seinen Sohn.“ – Oder neudeutsch ausgedrückt: Der Lockdown ist vorbei!
Domkapitular Clemens Bieber
www.caritas-wuerzburg.de
Text zur Besinnung
Wenn Weihnachten
nur zum Tannenbaum
und nicht zur Krippe,
zum Kind,
führt,
dann sind wir nicht auf dem Weihnachtsweg,
sondern auf dem Holzweg.
(Autor unbekannt)