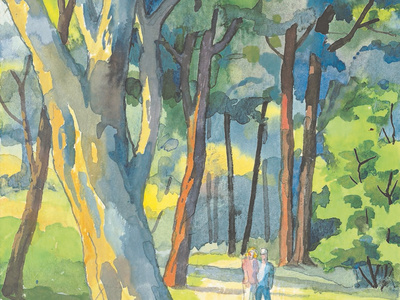Die Predigt im Wortlaut:
„Es kommt in Zukunft darauf an, dass wir ‚Geh-hin-Kirche‘ sind!“ Das war die Botschaft der ersten Predigt, die ich vor 45 Jahren im Priesterseminar am Beginn des Studiums vom damaligen Regens Heinz Röschert hörte. Es war üblich, dass wir in den ersten Tagen des neuen Semesters den Eröffnungsgottesdienst am Käppele in Würzburg feierten.
„Es kommt in Zukunft darauf an, dass wir ‚Geh-hin-Kirche‘ sind! … Wir dürfen uns nicht damit begnügen, ‚Komm-her-Kirche‘ zu sein!“
Diese Botschaft ist auch nach Jahrzehnten höchst aktuell! In den gravierenden Umbrüchen unserer Tage – gesellschaftlich wie auch kirchlich – sind wir dabei, neue Strukturen und damit Orte und Angebote zu schaffen, an denen uns die Menschen erreichen können. Doch – das war die Botschaft an uns Priesteramtskandidaten – das wird nicht ausreichen. Unsere Sendung ist, zu den Menschen zu gehen, wie es auch im Leitwort unserer Diözese zum Ausdruck kommt: „Christsein unter den Menschen!“
Die 2023 von evangelischer und katholischer Kirche gemeinsam in Auftrag gegebene „Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung“ (KMU) belegt die Entwicklung der sich stark verkleinernden christlichen Kirchen in Deutschland. Nicht einmal mehr die Hälfte der Menschen in unserem Land gehören einer der beiden Kirchen an. Die Studie belegt auch, dass mit dem Verlust der Bindung an die Kirche und damit der mehr oder weniger regelmäßigen Glaubenspraxis im Laufe der Zeit auch der Glauben verloren geht.
Gewiss sind die säkulare gesellschaftliche Großwetterlage und der Einfluss der Medien bzw. der Meinungsmacher in den Medien, die stark ihre eigene persönliche Haltung vermitteln, dafür zum Teil mit verantwortlich. Aber auch die mangelnde Präsenz der Kirche bei den Menschen und in den Lebensräumen der Menschen wirken sich in dieser Entwicklung aus.
In diesem Zusammenhang möchte ich auf zwei aktuelle Untersuchungen hinweisen:
- Der Münsteraner Religionssoziologe Detlef Pollack erklärte den Bedeutungsverlust von Religion durch Faktoren wie wachsenden Wohlstand, Demokratisierung, Ausbau des Sozialstaats sowie Individualisierung und kulturelle Pluralisierung.
- Vor diesem Hintergrund sind die Feststellungen des Bochumer Theologen Matthias Sellmann interessant. Er sagt, wo Kirche gut arbeitet, steigt die Wahrscheinlichkeit von glaubwürdigen Begegnungen. Wo Menschen über Religion reden, über ihren Glauben, über das, was sie antreibt, stößt man normalerweise auf großes Interesse. „Das hat dann aber auch mit inspirierenden Liturgien zu tun. Das große Geheimnis von Gottesdiensten, von Weltkirche – wir haben es beim Konklave erlebt, wie interessant und geheimnisvoll das sein kann …“
Weiterhin erinnert Sellmann: „Und dann stellt sich die Frage, wie diakonisch diese Kirche ist? Ist sie wirklich an meiner Seite, wenn es mir schlecht geht? Und zwar nicht abstrakt, sondern ganz konkret in faszinierenden, helfenden Persönlichkeiten …“ und mit ihren vielfältigen Diensten.
Deshalb stellt Sellmann fest: „Kirche sollte insgesamt als ‚Dienstleister für gelingendes Leben und für gelingende Kommunen‘ erkennbar sein. … Seelsorge ist ein weiterer ganz wichtiger Punkt. Seelsorge ist eigentlich überall vonnöten, nicht nur innerkirchlich.“
„Es kommt in Zukunft darauf an, dass wir ‚Geh-hin-Kirche‘ sind!“ Diesem Gedanken gehen wir heute bei der Feier unseres Diözesanpatrons Kilian und seiner Gefährten nach. Die Festwoche, die wir jetzt begehen, will uns alljährlich an den Auftrag Jesu erinnern, den Menschen SEINE Frohe Botschaft als Wegweisung zu einem erfüllten, zufriedenen und beglückenden Leben zu bezeugen, – ein Auftrag, dem der große Heilige als Missionar folgte.
Der Sendung Jesu, allen Menschen SEINE Botschaft zu verkünden, waren die Christen von Anfang an gefolgt. So konnte durch die kleine Gruppe von Gläubigen innerhalb von drei Jahrhunderten eine weltumspannende Religion werden – und das ohne Waffen und trotz Verfolgung und Spott durch die Eliten ihrer Zeit.
Die Christen blieben nicht unter sich, sondern machten sich auf den Weg, knüpften enge soziale Netze. Dabei haben sie alle gesellschaftlichen Schichten angesprochen, haben soziale Schranken überwunden und vielen Menschen in ganz unterschiedlichen Situationen einen Sinn für ihr Leben eröffnet. Daraus ergaben sich zahlreiche konkrete Auswirkungen der Frohen Botschaft Jesu wie Mildtätigkeit, Mitleid und die Hoffnung auf Auferstehung. Die frühen Christen verbanden Glaubenspraxis und soziales Handeln. Sie sorgten für Arme, Alte, Kranke und kümmerten sich um würdige Bestattungen.
Jesu Botschaft ist darauf angelegt, den Menschen verkündigt zu werden. Deswegen dürfen wir uns als Kirche nicht einigeln, sondern müssen uns unter die Menschen mischen. Jesus selbst fordert dazu auf. „Geht!“, so sagt er im Evangelium heute auch zu uns.
Dass ich bereit bin, etwas weiterzusagen und weiterzugeben, setzt aber voraus, dass ich von der Richtigkeit der Sache überzeugt bin. Nur wenn ich von der Frohen Botschaft und ihrer Bedeutung für das Leben überzeugt bin, werde ich sie auch weitersagen und mithelfen, dass sie weitergegeben werden kann.
Der aus unserer Diözese, nämlich aus Mömbris im Kahlgrund stammende Jesuit Pater Ivo Zeiger prägte beim ersten deutschen Katholikentag nach dem Krieg 1948 in Mainz das Wort: „Deutschland – Missionsland!“ Für die Menschen zeigten sich drei Jahre nach der Katastrophe des Dritten Reiches und des Zweiten Weltkriegs erste Anzeichen einer materiell besseren Zukunft. Die Sorge von Ivo Zeiger war, dass zugleich die Weitsicht für das Wesentliche im Leben verlorengeht. Deshalb war das Leitwort des damaligen Katholikentags bedeutsam: „Nicht klagen, handeln!“ Darauf kommt es auch heute in den gewaltigen Umbrüchen in Kirche, Gesellschaft und Welt an.
Mehr als es uns vielleicht im Augenblick klar ist, ist es für die Menschen heute notwendig, dass sie von der Frohen Botschaft erfahren. Das ist aber nicht nur Aufgabe für hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kirche, das ist Auftrag von Jesus selbst an alle, die an ihn glauben und ihm folgen. Dies setzt jedoch voraus, dass ich selbst die Bedeutung der Frohen Botschaft für mein Leben erkenne.
Das heutige Evangelium gibt uns wichtige Hinweise, wie wir die Frohe Botschaft in unserer Zeit weitergeben können.
- Jesus schickt die Jünger aus. Sie sollen mit ihrer Person Zeugnis von seiner Botschaft und von seinen Taten ablegen. Botschaft und Bote gehören also untrennbar zusammen.
- Er sendet sie miteinander aus. Die heute oft geäußerte Haltung: „Ich kann auch ohne Kirche glauben“, ist auf Dauer nicht möglich, wie die schon erwähnte KMU belegt. Spätestens wenn Schwierigkeiten auftauchen, braucht es den Rückhalt der Gemeinschaft.
- Durch ihr gemeinsames Auftreten und ihren konkreten Einsatz machen sie Jesus sichtbar: „Heilt die Kranken, die dort sind, und sagt ihnen: Das Reich Gottes ist euch nahe!“
Unser Christsein kann nicht auf das persönliche Zeugnis verzichten – in der Schule, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde, in der Gesellschaft, in der Politik, in den Medien. Überall gilt, dass nur durch das persönliche Zeugnis die frohe Botschaft verkündet werden kann.
Ebenso braucht unser Christsein die Gemeinschaft mit den anderen Glaubenden. Den Menschen, der Welt wird Gottes Reich vor Augen geführt durch das gemeinsame Zeugnis von überzeugten Christen.
Auch auf das Erscheinungsbild der Jünger kommt es an. Sie sollen ihren Besitz auf das Nötigste reduzieren. Dahinter steckt der Hinweis, offen zu sein für die Nöte von Mitmenschen und bereit zu sein, auch Verzicht zu üben, um damit anderen zu helfen. Doch wer viel verdient und deswegen viel Steuern zahlt, wird – wenn ihm die Frohe Botschaft nicht wirklich wichtig ist – z.B. den Kirchenbeitrag sparen wollen, damit ihm noch etwas mehr bleibt. Ob so ein Mensch viel von der Frohen Botschaft begriffen hat, bleibt die Frage!
Wer aber – gerade heute – bereit ist, Zeichen zu setzen für seinen Glauben und für seine Bereitschaft, sich von Jesus senden zu lassen, der muss wissen, dass dies nicht immer einfach ist. „Ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe!“ Doch bei allem Widerstand, auf den die Boten treffen: Sie sind nie allein! Zum einen sind sie miteinander ausgesandt worden, d.h. ihr Zeugnis gewinnt durch die Gemeinschaft mehr Kraft und Autorität. Zum anderen können sie sich gegenseitig stützen und im Glauben bestärken; eine Fähigkeit, die gerade heute unseren Gemeinden verstärkt zukommen müsste.
Noch ein letzter Gedanke im Blick auf unsere Gesellschaft. Der Glaube ist von großer Bedeutung für das Gemeinwesen. Der ehemalige Verfassungsrichter Paul Kirchhof bezeichnete dieser Tage das Christentum als eine Wurzel für Freiheit und Verantwortung. Deshalb fordert er die Kirchen auf, ihren Freiraum mutig auszufüllen. Er mahnt: „Wer Gott vergisst, gefährdet die Freiheit.“ Im Blick auf den Staat sagt er, es gelte, das Christentum als eine der Wurzeln der deutschen Verfassung zu pflegen. Mit dem Grundgesetz sei es wie mit einem Baum: „Die Verfassung kann nur gedeihen, wenn diese Wurzeln nicht verdorren.“
Der Appell von Regens Röschert zur „Geh-hin-Kirche“ wie auch das klare Wort von Paul Kirchhof – „Wer Gott vergisst, gefährdet die Freiheit“ – mögen uns ebenso wie der Missionar unserer Heimat, der hl. Kilian, Ermutigung zum Christsein in unserer Zeit sein.
Domkapitular Clemens Bieber
www.caritas-wuerzburg.de
Text zur Besinnung
Es war einmal!?
Sind wir die Letzten, die glauben,
glauben an das, was war,
sind wir nur übrig geblieben,
übrig von dem, was war?
Andere sehn nur das Heute,
sehen nur das, was ist.
Sind wir die Letzten, die glauben,
glauben an das, was war?
Oder?
Sind wir die Ersten, die glauben,
glauben an das, was wird,
sind wir die Vorhut von morgen,
Vorhut von dem, was wird?
Andere sehn nur das Heute,
sehen nur das, was ist.
Sind wir die Ersten, die glauben,
glauben an das, was wird?
(Lothar Zenetti)